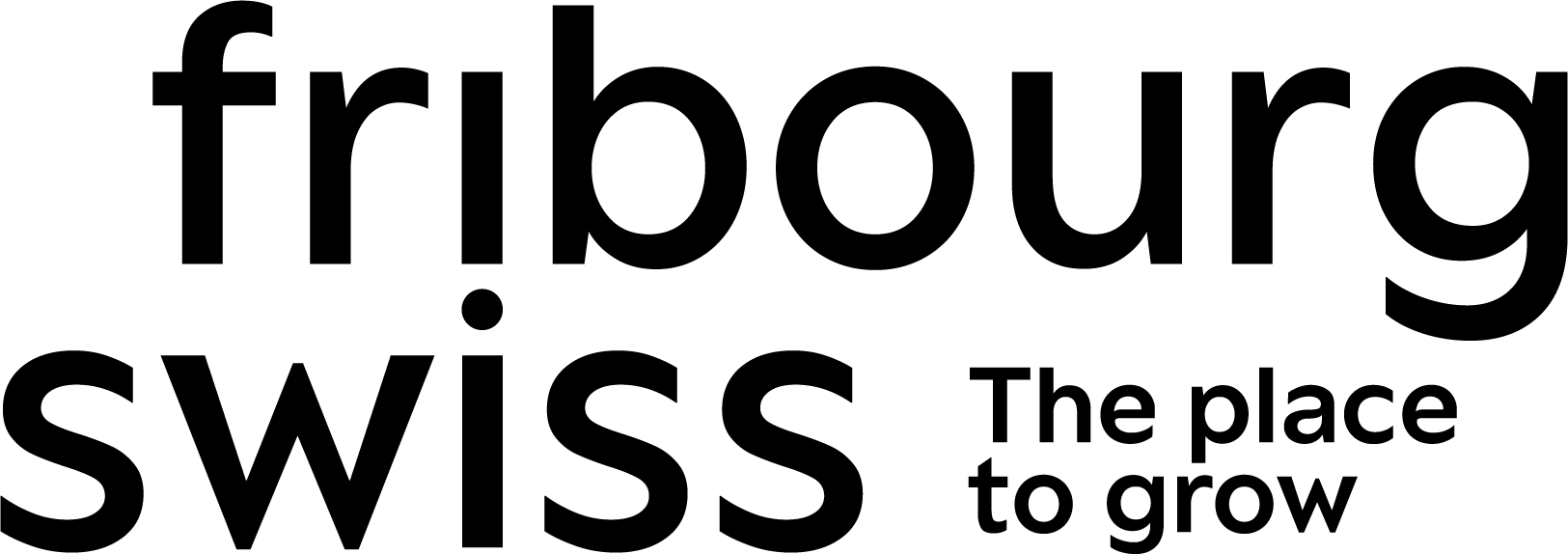Die Doktorandin der Marketingwissenschaften, erfahrene Dozentin und Hotelfachfrau Mikèle Landry verbindet akademische Präzision mit praktischer Erfahrung. Nach Lehrtätigkeiten an der Universität Freiburg und der Hotelfachschule Lausanne arbeitet sie seit 2025 als Head of Luxury Brand Strategy Specialization im Bachelor-Studiengang International Hospitality Business am Glion Institute of Higher Education (GIHE). Sie vermittelt den Studierenden des Bachelor-Studiengangs einen fundierten, kritischen und zugleich offenen Ansatz in Bezug auf Luxus. In diesem Interview spricht sie über die Codes des Luxus, Storytelling, die Verantwortung von Marken und die Lehren, die KMU daraus ziehen können.
Wie definieren Sie Luxus in Ihrer Lehrtätigkeit und in Ihrem Austausch mit den Studierenden?
Es gibt keine einheitliche Definition von Luxus. Ich versuche meinen Studierenden die Vielfalt der Perspektiven zu vermitteln – sei es in der Literatur, unter Fachleuten oder Konsumentinnen und Konsumenten – und ihnen zu zeigen, wie wichtig es ist, immer wiederkehrende Kriterien zu erkennen. Grundlegend ist der Begriff der Erfahrung: Luxus hat nicht nur mit einem hohen Preis oder mit Rarität zu tun, sondern beruht auf einer ganzheitlichen Erfahrung, die lange vor dem Kauf beginnt und weit über ihn hinausgeht. Er spricht die Sinne, die Emotionen und die Fantasie an. Sein Wert beruht nicht nur auf dem Produkt oder der Dienstleistung, sondern auch auf der oft sehr persönlichen Beziehung zwischen der Marke und dem Kunden. Luxus entsteht auch durch psychologische (Status, Differenzierung) und symbolische (Tradition, Know-how, Markenwelt) Aspekte.
Wie sprechen Sie mit einer Generation über Luxus, die mit der Allgegenwart der digitalen Technologie aufgewachsen ist?
Unsere Studierenden sind sehr versiert im Umgang mit digitalen Medien: Sie beherrschen die Tools und kennen die Marken, deren Universen und Kampagnen. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie immer eine kritische Distanz einnehmen. Unsere Aufgabe ist es, ihnen dabei zu helfen, über den reinen Konsum von Informationen hinauszugehen, um die eingesetzten Strategien zu verstehen und zu erkennen, wie Identität, Segmentierung und Vertriebskanäle miteinander verknüpft sind. Im Luxussegment ist die persönliche Interaktion nach wie vor sehr wichtig: Digitale Technologien dürfen den Menschen nicht ersetzen, sondern müssen das Erlebnis bereichern, ohne die zwischenmenschliche Dimension auszuklammern. Die Studierenden lernen, die digitale Welt und persönliche Interaktionen zu kombinieren. Diese Fähigkeit ist insbesondere im Hotelgewerbe oder in der Kommunikation unerlässlich geworden.
Storytelling ist eng mit dem Kundenerlebnis verknüpft und scheint mittlerweile genauso wichtig wie das Produkt selbst zu sein, wenn nicht sogar wichtiger. Wie erklären Sie sich diese Entwicklung?
Sie entspricht einem wachsenden Bedürfnis nach Authentizität und Kohärenz. Die Konsumenten begnügen sich nicht mehr mit einem schönen Objekt: Sie wollen verstehen, wofür die Marke steht und eine echte Verbindung zwischen ihren Werten und ihrem Handeln erkennen. Storytelling wird so zu einem emotionalen roten Faden und zu einem identitätsstiftenden Merkmal.
Wenn Storytelling gut aufgebaut ist, verbindet es alle Berührungspunkte mit den Kunden, stärkt den wahrgenommenen Wert und schafft ein Gefühl der Zugehörigkeit, auch wenn das Produkt objektiv gesehen nicht einzigartig ist. Marken wie Cartier, Rolex, Patek Philippe oder grosse Hotelbetriebe sind gute Beispiele: Ihre Kommunikation basiert auf kohärenten Erzählungen, die uns in eine andere Welt entführen. Damit dies funktioniert, muss die Erzählung jedoch in der Kultur der Marke verankert sein – allgemein gültiges Storytelling reicht nicht aus.
Wie bringt man Studierenden in einer so kodifizierten Welt wie der Luxusbranche das Storytelling bei?
Wir beginnen mit Beobachtung: Welche Marken erzählen ihre Geschichte gut, warum und wie? Anschliessend entwickeln die Studierenden ihre eigenen Narrative. Sie lernen, Klischees zu vermeiden, nach Alleinstellungsmerkmalen zu suchen und die Botschaft mit der DNA der Marke zu verknüpfen. Diese Arbeit fördert ihre Kreativität, ihre Präzision und ihr strategisches Denken. Storytelling wird zu einem Werkzeug, um über die Marke als Ganzes nachzudenken: ihre Vision, ihre Strategie, ihre Differenzierung und den geschaffenen Wert.
Können sich Freiburger und Schweizer KMU trotz begrenzter Mittel von den Codes der Luxusbranche inspirieren lassen?
Auf jeden Fall. Es ist keine Frage des Budgets, sondern der Klarheit. Ein KMU, das weiss, wofür es steht, das seine Werte klar definiert und sie kohärent verkörpert, kann durchaus eine starke emotionale Bindung zu seinen Kunden aufbauen. Dies setzt voraus, dass man über das Kundenerlebnis nachdenkt: Was empfindet der Kunde konkret? Was geht über den rein funktionalen Akt hinaus? Wie kann eine besondere Beziehung zum Kunden aufgebaut werden, damit seine Erfahrung positiv, einzigartig und unvergesslich ist?
Wie kann dieser Ansatz über die blosse Erfüllung einer Nachfrage weiterverfolgt werden?
Luxus entspricht manchmal nicht einem unmittelbaren Bedürfnis: Er schafft auch Begierden. Eine solche Haltung erfordert echte strategische Klarheit, Weitsicht und mutige Entscheidungen, auch wenn man damit gegen den Strom schwimmt. Ein KMU kann wie eine Luxusmarke denken, wenn es bis ins kleinste Detail zu sich selber steht. Das Wichtigste ist, in allen Interaktionen aufrichtig, konsequent und aufmerksam zu sein.
Was denken Sie über die heutige Verantwortung von Luxusmarken? Glauben Sie, dass sie Werte wie Nachhaltigkeit oder Ethik vertreten sollen, oder sogar müssen?
Sie müssen… denn wir befinden uns in einer Zeit, in der tiefgreifende Veränderungen notwendig sind, sowohl in ökologischer als auch in sozialer Hinsicht. Das Luxussegment darf sich als exponierte und richtungsweisende Branche nicht mehr damit zufriedengeben, nur zu kompensieren oder zu kommunizieren: Es muss die Grundsätze der Nachhaltigkeit in seine Praktiken integrieren, in die Entwicklung, die Produktion, die Partnerschaften und die Unternehmensführung. Einige Marken gehen bereits mit gutem Beispiel voran und verlangen von ihren Lieferanten ein konkretes Engagement. Dies ist jedoch noch nicht die Norm. Sie haben auch eine Aufgabe, was die Veränderung der Mentalitäten betrifft, indem sie ihre Kunden aufklären und dabei auf das aufgebaute Vertrauensverhältnis zählen können.
Welche Rolle spielen die jungen Generationen – insbesondere die Studierenden von Glion – in dieser Entwicklung?
Eine zentrale Rolle. Oft sind sie es, die diesen Wandel vorantreiben, da sie die Probleme klar erkennen. Bei uns werden diese Themen in einem speziellen Kurs zum Thema Unternehmensverantwortung als auch im gesamten Studiengang behandelt. Wenn unsere Studierenden die Hochschule verlassen, verfügen sie über die notwendigen Werkzeuge, um aktiv zu werden und Veränderungen voranzutreiben. Sie sind die engagierten Fachkräfte von morgen, die einen verantwortungsvolleren Luxus verkörpern.